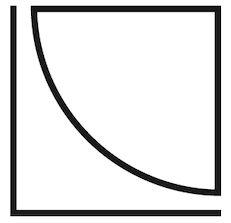Nun existiert auf der Welt „von Natur aus“ kein Gegenstand, der halb Motorrad halb Schlagzeug sein könnte. Auch die Technik wird sich hüten, so etwas zu bauen, das keinen Nutzen haben kann. Reiters Sache ist die Störung des Naturalismus. Seine Arbeiten enthalten daher auch Polemiken gegen jede konventionelle, vom Realitätssinn geleitete Abbildhaftigkeit. So sieht man wieder, dass Kunst von „künstlich“ kommt, dass sie eigene Regeln hat (das heißt: eigene Möglichkeiten) und dass ihr Zweck kein Verwendungszweck ist. Damit wird eben nicht behauptet, sie wäre unbrauchbar: Der Ausdruck von Freude, ja von Obsession, ist unverzichtbar, weil er sagt, dass einem Menschen auf Erden doch zu helfen war und dass wenigstens
nicht alle unglücklich sein müssen.
Der Ausdruck der Freude konkurriert mit dem Realitätssinn. Die vergegenständliche Mischung aus Motorrad und Schlagzeug haben etwas von der Art, in der Träume ihre eigene Realität zusammenbauen. Träume sind (wie einst die Mythen) nicht unvernünftig. Sie sind anders vernünftig, und die Kunst ist die gesellschaftlich eingeräumte und erlaubte Möglichkeit, mit dieser anderen Vernunft (und für sie) zu arbeiten.
Reiters Arbeitsweise ist nicht zuletzt im Persönlichen verankert. Der Künstler bearbeitet, sublimiert, aber vergröbert und dramatisiert auch Erfahrungen, die er auf seinem Lebensweg machte. Seine Kunst kalkuliert nicht kühl, sondern das emotionale, das „ausdrucksvolle“ Moment ist eines ihrer Kennzeichen.
Das Schlagzeug-Motorrad (oder Motorrad-Schlagzeug) zeugt davon und die ursprüngliche expressive Ehrlichkeit des Rock and Roll ist ein utopisches Motiv dieses Traum-Werks. Befasst man sich mit Reiters Werk dann begegnet man einem anderen Motiv, das aus Träumen nicht unbekannt ist: Felle und Haare, die einem in der Kunst Reiters an die Haut gehen.
Auszüge aus dem Text von Franz Schuh
Zurück
Zurück
Udo Rabensteiner
Weiter
Weiter